Muskelfaserriss
Ein Muskelfaserriss ist eine meist sichtbare
Unterbrechung der Muskelstruktur (teilweise als Delle sichtbar und tastbar).
Die häufigste Ursache sind Maximalbelastungen in nicht ausreichend erwärmter
Muskulatur, sowie unverhältnismässig starke Überdehnung.
Im Sport treten recht häufig Verletzungen im Bereich der Muskulatur auf. Die
häufigsten Verletzungsformen im Bereich der Muskulatur sind die
Muskelzerrungen die Muskelfaserrisse und der Muskelriss in individuell
unterschiedlichem Ausmass. Alle drei genannten Verletzungsformen sind auf eine
muskuläre Störung zurückzuführen, bei gleichzeitigem Auftreten einer muskulären
Dekompensation, beispielsweise in Form von Muskelermüdungen.
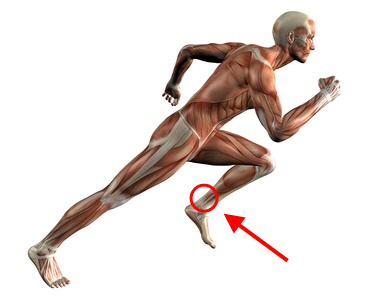 Man
spricht von einer Muskelzerrung, wenn der Muskel über sein natürliches Mass
hinweg gedehnt wird. Die anatomische Struktur des Muskels verändert sich bei
einer Zerrung nicht. Erst wenn über diese Muskelzerrung hinweg die Kraft, bzw.
die Belastung des Muskels weiterhin überschritten wird, treten Verletzungen wie
Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse oder gar Muskelrisse ein.
Man
spricht von einer Muskelzerrung, wenn der Muskel über sein natürliches Mass
hinweg gedehnt wird. Die anatomische Struktur des Muskels verändert sich bei
einer Zerrung nicht. Erst wenn über diese Muskelzerrung hinweg die Kraft, bzw.
die Belastung des Muskels weiterhin überschritten wird, treten Verletzungen wie
Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse oder gar Muskelrisse ein.
Im Falle eines Muskelfaserriss reissen die sehr kleinen Fasern der Muskulatur
ein, während bei einem Muskelriss der Muskel als solches vollständig durchtrennt
wird. Da der Muskel als solches recht widerstandsfähig ist, treten Muskelrisse
nur dann auf, wenn der Muskel unter maximaler Beanspruchung steht und in der
Regel bereits vorgeschädigt war.
Alle oben beschriebenen Verletzungen müssen auf Fehlfunktionen in der Muskulatur, wie beispielsweise Muskelermüdung, Ungleichgewicht des Stoffwechsels oder Überbelastung in Folge einer fehlerhaften Kommunikation zwischen Nervenbahnen und Muskulatur zurückgeführt werden. Muskelzerrung, Muskelfaserriss und Muskelriss stellen dabei ein und dieselbe Muskelverletzung dar, die sich lediglich in der Schwere der Verletzung unterscheidet.
Ursachen des Muskelfaserriss
Menschen, die zu einer Muskelverhärtung neigen, sind tendenziell häufiger von Verletzungen im Bereich des Muskels betroffen.
Zu den häufigsten Ursachen für Verletzungen im Bereich der Muskulatur zählen plötzlich auftretende Maximalbelastungen, wie beispielsweise
Beschleunigungen (Endspurt, schnelles Ansprinten, ...) oder Kombinationen aus beschleunigen und abbremsen, wie sie beispielsweise im Tennis oder Fussball auftreten. Zerrungen und Muskelfaserrisse resultieren dann stets aus der kurzzeitigen Extrembelastung im Bereich der Muskelschnellkraft, sodass der Muskel die plötzlichen mechanischen Zugkräfte nicht mehr auf-, bzw. abfangen kann.
Auch kalte und feuchte Witterung oder ein unzureichendes Aufwärmen vor sportlichen Betätigungen zählen zu den Ursachen.

Diagnose
Wie bereits oben erwähnt, unterscheiden sich die
Muskelverletzung in ihrer Schwere und in der Art des Schmerzes. Aus diesem Grund
ist die Schmerzbeschreibung durch den Patienten zur Diagnoseerhebung in
besonderer Weise Aufschluss gebend.
Generell treten bei Muskelverletzungen wie Muskelfaserriss Druck- Dehn- und
Anspannungsschmerzen auf. Der Patient begibt sich in eine Schonhaltung, die sich
beispielsweise bei Muskelverletzungen am Bein durch Humpeln oder ähnliches
äussern kann.
Bei Zerrungen ist über die Patientenbeschreibung in Form von rasch zunehmenden
krampfartigen Schmerzen hinaus eine spindelförmig, abgrenzbare Zone ertastbar.
 Der
akut auftretende, stechende Schmerz beim Muskelfaserriss oder Muskelriss
zeichnet sich gegebenenfalls durch ein äusserlich sichtbares Hämatom
(Bluterguss) aus.
Der
akut auftretende, stechende Schmerz beim Muskelfaserriss oder Muskelriss
zeichnet sich gegebenenfalls durch ein äusserlich sichtbares Hämatom
(Bluterguss) aus.
Bei einem Muskelriss kann eine Delle durch die
Auswölbung von Muskelteilen sichtbar werden, die später durch Schwellungen nicht
mehr sichtbar wird. Für einen Muskelriss spricht auch ein partieller, bzw. ein
kompletter Funktionsverlust des Muskels und wieder auftretende stechende
Schmerzen bei Muskelkontraktion (Muskelanspannung).
Der Arzt ermittelt nicht nur per Abtasten und Augenschein die Verletzung des
Muskelfaserriss, sondern prüft mittels spezifischer Bewegungstests das Ausmass
der Einschränkung.
Speziell der Widerstandstest, bei dem der Patient den Muskel anspannt während
der Arzt (Orthopäde) einen Gegendruck ausübt, macht die Einschränkung und das
Ausmass der Schmerzen erkenntlich.
Komplikationen
Bei Muskelfaserrissen und Muskelrissen
kommt es – bedingt durch die Ruptur zu inter-, bzw. intramuskulären Blutungen
und somit zur Hämatombildung.
Bei starken Einblutungen bildet sich der Verletzungsbereich nicht (vollständig)
zurück. Bindegewebe wächst in den Bluterguss ein und es entwickelt sich ein
Narbenplatte, die – wie bereits oben beschrieben – nicht so elastisch ist wie
das Muskelgewebe. Somit setzt sich der Muskel aus vielen Bereichen mit
unterschiedlicher Elastizität zusammen: Muskelbereiche, Muskelfasern, die sich
neu gebildet haben und kürzer sind, Narbengewebe, das weniger elastisch ist...
Aus diesem Grund ist die Kontraktionsfähigkeit und die Kraftausübung des Muskels
im Vergleich zum Zeitraum vor der Verletzung erheblich vermindert und auch
anfälliger für neue Verletzungen, insbesondere für erneute Muskelfaserrisse,
Muskelrissen oder Nachblutungen im neu regenerierten Bereich. Unter Umständen
ist der Patient auch nach vollständiger Ausheilung der Erkrankung immer noch
nicht beschwerdefrei.
Meist liegt das am ausgeprägten Narbengewebe oder Verkalkungen im Bereich der
Verletzung, das in seltenen Fällen sogar operativ entfernt werden muss.
Es gibt noch weitere klassische Komplikationen, die nach einem Muskelfaserriss
oder Muskelriss auftreten können. Nachfolgend wird auf zwei klassische
Krankheitsbilder nach einer solchen Erkrankung eingegangen werden.
Es sind diese:
Myositis ossificans: Durch
Schädigung des Muskels infolge von Muskelfaserrissen oder Muskelrissen, starken
Muskelprellungen oder –quetschungen und dadurch hervorgerufene intra- bzw.
intermuskuläre Blutungen, kann es bei unzulänglicher Behandlung oder
beispielsweise bei zu früh einsetzender Massage (siehe oben), zu früh
einsetzendem Training usw. zu einer Kapselbildung der Verletzung kommen.
In der Folge wird die Entzündung chronisch und es kommt zu einer Umwandlung der
Muskulatur und schliesslich zu Kalkeinlagerungen, die unter Umständen langsam
verknöchern. Ähnlich wie bei der Bildung des Narbengewebes entstehen durch die
Verknöcherungen im Muskel Bereiche mit unterschiedlicher Dehnbarkeit und
Kontraktionsfähigkeit.
Die Folge ist eine differierende Kontraktionskraft des Muskels und somit ein
erhöhtes Risiko, dass Verletzungen in diesen Bereichen erneut auftreten. In
Fällen von nachweislichen Verknöcherungen (Röntgenbilddiagnostik) kann unter
Umständen ein operativer Eingriff in Betracht gezogen werden. Die Gefahr durch
die OP weitere Verknöcherungen auszulösen besteht.
Entstehung von Zysten: Zysten
sind durch eine Kapsel abgeschlossene sackartige Geschwülste mit einem flüssigen
Inhalt. Im Bereich von Muskelverletzungen spricht man von einer Zystenbildung,
wenn es um einen nicht absorbierten Bluterguss herum zu einer Kapselbildung
kommt. Im Inneren befindet sich dann das nicht abgebaute Blut des ursprünglichen
Hämatoms. Sollte sich die Zyste störend auswirken, müssen sie gegebenenfalls
operativ entfernt werden. Insbesondere wenn der Bluterguss noch flüssig ist oder
dieses aus reiner Wundflüssigkeit (Serom) besteht, sollte dieses abpunktiert
werden.